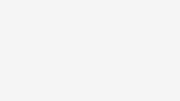von VOLKER SEITZ
Berlin – Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) meldet am 11. April 2017 stolz, dass Deutschland zweitgrößter Entwicklungshilfegeber (nach den USA) weltweit ist. Das geht aus den am gleichen Tag veröffentlichten Zahlen der OECD für die Official Development Assistance (ODA) hervor. Das 0,7-Ziel (der Anteil der öffentlichen Ausgaben für Entwicklungshilfe soll 0,7 Prozent am Bruttonationaleinkommen eines Landes betragen) wurde damit erreicht. Diese Pressemeldung wäre es nicht wert zu kommentieren, wäre da nicht die Behauptung von Bundesentwicklungsminister Gerd Müller: „Jeder Euro unserer Entwicklungszusammenarbeit vor Ort kommt den Menschen direkt zu Gute, schafft Bleibeperspektiven und erzielt vor Ort ein Vielfaches an Wirkung.“ Seit Jahren behaupten BMZ Minister, dass kein Pfennig oder Cent der Entwicklungshilfe in dunklen Kanälen verschwindet. Sie hatten und haben einen eigenwilligen Blick auf die Wirklichkeit.
Die Diskussion um das 0,7-Ziel lenkt von den wirklichen Problemen ab. Das ist der Beitrag, der schließlich dem fatalen Denken Vorschub leistet, dass mehr Geld mehr Entwicklung bringt. Die Verfolgung des Zieles vergrößert das Problem des Mittelabflusses und damit die Gefahr fragwürdiger Ausgaben. Deshalb ist das Armenhaus Afrika seit 50 Jahren ein Versuchslabor der Betreuungsindustrie. Noch immer werden in Afrika die Ziele der Entwicklungshilfe meist von den Gebern gesetzt, und die Afrikaner bleiben Zuschauer. Viele Afrikaner sehen mittlerweile westliche „Hilfe“ als militanten Egoismus. Finanzielle Hilfen im Rahmen der Entwicklungshilfe können nur greifen, wenn bestimmte Voraussetzungen gegeben sind. Die Hilfe muss endlich an eine realistische Bevölkerungspolitik gekoppelt werden.
Die Wurzeln der anhaltenden Armut in Afrika liegen in der demografischen Situation, die Wohlstandsgewinne vereitelt. Es bedarf einer verlässlichen Regierungsführung, die nicht korrupt ist, die Zusagen einhält, die im Rohstoffsektor transparent ist, bei der es keine illegalen Finanzflüsse gibt. Afrikaner wie Themba Sono, Wole Soyinka, Andrew Mwemba, George Ayittey sind überzeugt, dass Wohlstand nicht durch milde Gaben entsteht, sondern durch unternehmerische Kreativität, Arbeit, Innovation – und durch gute staatliche Rahmenbedingungen. „Gut gemeint“ ist bekanntlich meist das Gegenteil von gut gemacht. Die Betroffenen werden selbst nicht gefragt, wie sie zur Entwicklungshilfe stehen, und was ihnen ihrer Meinung nach helfen könnte. Afrikaner als Mündel zu betrachten, ist die unausgesprochene Geschäftsgrundlage der allermeisten „Projekte“. Die Liste der Kritiker klassischer Entwicklungshilfe ist in den vergangenen Jahren ständig gestiegen. Einzelne Hilfsprojekte mögen sinnvoll sein. Aber Projekte ersetzen keine Strukturen.
Andrea Böhm schrieb in der Zeit: „Warum ist es für die Bonos und Madonnas – und damit auch für die westliche Öffentlichkeit – immer noch so verdammt schwer, selbständig handelnde Menschen in afrikanischen Ländern zur Kenntnis zu nehmen? Es geht ja nicht darum, deren oft existenzielle Probleme zu leugnen. Es geht darum, dass dortige Akteure sehr wohl in der Lage sind, diese Probleme selbst darzulegen.“ Eine erfolgreiche Entwicklung ist das Ergebnis von Eigenverantwortung. Allgemeingut ist geworden, dass die Welt nur wenig tun kann, diese von außen zu beeinflussen. Auch langjährige Afrika-Korrespondenten wie Thomas Scheen, Thielo Thielke, Michael Bitala und Wolfgang Drechsler raten zu einer dringenden Änderung der bisherigen Entwicklungspolitik. „Hilfe ist wie Öl, sie erlaubt mächtigen Eliten, öffentliche Einnahmen zu veruntreuen“, schrieb der Ökonom Paul Collier von der Universität Oxford.
Für Entwicklungsökonom Axel Dreher (Universität Heidelberg) ist schon die Zahl an sich aus der Luft gegriffen. Die Angaben könne man mit Buchungstricks ausgleichen. So würden auch Projekte in der Flüchtlingspolitik bei der Entwicklungsarbeit mit gebucht. Ein Trick, um auf eine bessere Bilanz zu kommen. Zudem gibt er zu bedenken, welches private Unternehmen seine Lohnkosten in Höhe von 0,7 Prozent des Umsatzes definieren würde? Der Experte fordert stattdessen realistischere und konkretere Ziele. „Man könnte sich zum Beispiel vornehmen, Malaria auszurotten. Daran könnte man sich messen lassen. Das wäre mehr als Symbolpolitik.“
Volker Seitz war von 1965 bis 2008 in verschiedenen Funktionen für das deutsche Auswärtige Amt tätig, zuletzt als Botschafter in Kamerun, der Zentralafrikanischen Republik und Äquatorialguinea mit Sitz in Jaunde. Er gehört zum Initiativ-Kreis des Bonner Aufrufs zur Reform der Entwicklungshilfe und ist Autor des Buches „Afrika wird armregiert“, das im Herbst 2014 in erweiterter siebter Auflage bei dtv erschienen ist. Volker Seitz publiziert regelmäßig zum Thema Entwicklungszusammenarbeit mit Afrika und hält Vorträge.
Bildquelle:
- Afrika_Kontinent: pixabay