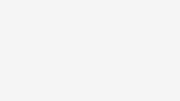WIEN – Österreich wählt in gut drei Wochen einen neuen Bundespräsidenten. Oder vielleicht auch nicht: Der Amtsinhaber, Alexander van der Bellen, hat exzellente Chancen, wiedergewählt zu werden. Spannender ist daher das Rennen um Platz zwei, das am 9. Oktober entschieden werden dürfte.
Die Österreicher haben eine Tradition: Sie wählen ihre Staatsoberhäupter selbst, direkt. Und wenn sie können, dann am liebsten denjenigen, der es bisher schon war. Alle sechs Jahre findet der Urnengang statt, einmal darf der gewählte Bundespräsident wiedergewählt werden. Folkloristisch wird der österreichische Bundespräsident gern als ein Ersatzkaiser bezeichnet. Man sollte den obersten Hofburgbewohner vor allem politisch keinesfalls unterschätzen, er ist nämlich von der Verfassung mit wesentlich weitreichenderen Rechten ausgestattet als sein Pendant in Schloss Bellevue. Darunter fallen etwa die Möglichkeit, den Nationalrat sowie die Landtage zu entlassen, zudem ernennt und entlässt er nach freiem Ermessen den Bundeskanzler und (über dessen Vorschlag) die Bundesminister.
Es ist durchaus bedeutsam, wer kandidiert
Amtsinhaber gewinnen zumeist schon im ersten Wahlgang mit deutlicher Zustimmung. Bezeichnend hierfür ist auch, dass das Maximum der Wünsche der anderen Kandidaten ist, den Amtsinhaber in eine Stichwahl zu zwingen.
Auch deshalb haben die beiden lange so bezeichneten Großparteien ÖVP und SPÖ keinen eigenen Kandidaten nominiert: Kein profilierter Politiker aus ihren Reihen hätte sich bereiterklärt, die absehbare Niederlage einzustreifen. Einen nicht profilierten Kandidaten ohne Siegchancen aufzustellen, wäre eine Vergeudung von Geld und Kraft, zumal es für die Wahlkampfkosten keine Rückerstattung gibt. Daher gibt es 2022 kein Angebot für sozialistisch oder konservativ eingestellte Wähler.
Anders hier das strategische Momentum der FPÖ
Schon seit Jahrzehnten nutzt sie die Wahl, bei der ihre Kandidaten bis auf 2016 nie auch nur in die Nähe eines starken Ergebnisses kamen, dafür, eine Persönlichkeit aus ihren Reihen bundesweit bekannt zu machen. Der Kandidat von 2016, Norbert Hofer, wurde später Bundesminister und zeitweise auch Parteichef. Diesmal schickt man den ehemaligen Fraktionschef Walter Rosenkranz ins Rennen. Der hat ein präsentables Auftreten und ist kein populistischer Schreihals, doch er gilt als ideologisch gefestigter Nationaler. Seine Ankündigung, die Regierung im Falle seiner Wahl eventuell bald zu entlassen, wurde im Sommer heftig diskutiert, was FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz dazu veranlasste, im Verschwörungstheoretikersprech zu vermuten, dass „das System“ nun nervös werde. Die Umfragen sehen ihn derzeit zwischen 11 und 21 Prozent, was eine beachtliche Spanne ist.
Lesen Sie solche Analysen gern? Dann helfen Sie uns, dafür zu sorgen, dass unsere Stimme immer mehr Gehör findet. Durch Abschluss eines Abonnements oder eine Spende über PayPal @TheGermanZ oder eine Überweisung auf unser Konto: DE03 6849 2200 0002 1947 75.
Sehr viel bunter ist jener Mann, dem zugetraut wird, Rosenkranz‘ härtester Konkurrent um Platz zwei zu werden: Dominik Wlazny, besser bekannt als Marco Pogo. Der gebürtige Wiener ist Mediziner, Musiker, Kabarettist und Vorsitzender der Bierpartei. Was als Satireprojekt begann, hat zwar keine Aussicht auf strukturelle Mehrheiten, ist aber seit 2020 in den meisten der 23 Wiener Bezirksparlamente vertreten und hat als erste die benötigten 6000 Unterstützungserklärungen eingereicht. Wlazny steht gesellschaftspolitisch eher links, ist aber auch als Verteidiger individueller Freiheiten und Rechte auffällig geworden, also auch für klassisch Bürgerlich-Liberale wählbar. Als erfolgreicher Unternehmer und intelligent kommentierender Satiriker dürfte er für viele Bürgerliche attraktiv sein. Er liegt zwischen 5 und 14 Prozent.
Der dritte im Bunde ist der Rechtanwalt Tassilo Wallentin. Er gilt als FPÖ-nah, wo er dem populistischen Umfeld von Parteichef Kickl zuzuordnen wäre, der Wallentin auch als FPÖ-Kandidaten durchsetzen wollte. Wallentin war zuvor als Kolumnist der reichweitenstarken Kronenzeitung aufgefallen, wo er mit viel Verve das politische Zeitgeschehen kommentierte – allerdings, wie Kritiker bemängeln, es dabei oft an Sachlichkeit mangeln ließ. Insbesondere in EU-Fragen nahm es der Jurist nicht immer allzu genau, wenn es darum ging, die Vorgänge korrekt darzustellen. Nicht zuletzt das macht ihn im traditionell pro-europäischen konservativen Umfeld Österreichs etwas unbeliebt. Umfragen räumen ihm zwischen 6 und 11 Prozent ein.
Ein Kandidatenfeld, größer als jemals zuvor
Das Feld, das in diesem Jahr größer ist als je zuvor, wird durch einige Skurrilitäten ergänzt: So will der ehemalige BZÖ-Abgeordnete Gerald Grosz mit „Make Austria GROSZ again“ reüssieren. Ähnlich markige Sprüche sind vom Vorsitzenden der Impfgegnerpartei MFG, Michael Brunner, zu hören. Der Waldviertler Schuhhersteller Heinrich Staudinger gilt als linksgerichtet und als einziger tatsächlich nicht parteinaher Kandidat. Den drei letztgenannten werden derzeit jeweils 3 bis 10 Prozent eingeräumt.
Bemerkenswert ist, wie das nationalpopulistische Lager einander kannibalisiert. Ohne das Antreten von Wallentin, Brunner und Grosz hätte Walter Rosenkranz einen Wert zwischen 30 und 40 Prozent mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit erreichen können, vielleicht sogar über 40. So scheint dies kaum möglich. Dies zeigt auf, wie zerrissen dieses Lager derzeit ist. Die ernüchternden Erfahrungen nach Ibiza und der neuerlichen Regierungsbeteiligung haben sichtlich Spuren hinterlassen. Das „blaue“ Lager ist in einer Selbstfindungsphase und somit politisch derzeit faktisch ohne Wirkmächtigkeit.
Die Amtsführung von Alexander van der Bellen ging nicht ohne Kritik vonstatten – weniger als viele seiner Vorgänger habe er sich von seiner parteipolitischen Herkunft (er war von 1997 bis 2008 Parteichef der Grünen) getrennt. Andrerseits wird ihm zugutegehalten, in der Regierungskrise von 2019 mit Weitblick und ruhiger Hand reagiert zu haben. Die traditionellen Linien der österreichischen Außenpolitik hat er nicht verändert. Daher sind auch viele Bürgerliche und Konservative mit ihm nicht unzufrieden. Auch deshalb dürfte er vielleicht schon im ersten Wahlgang gewinnen.
Bildquelle:
- Alexander Van der Bellen: dpa