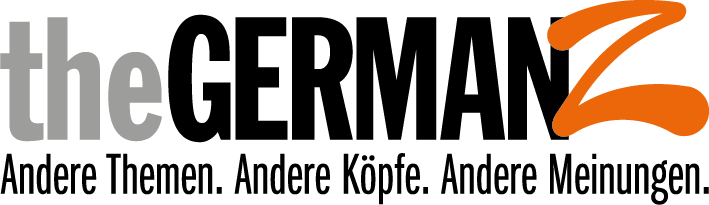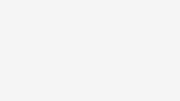von LUKAS MIHR
BERLIN – In den vergangenen Monaten ist es auch dem Letzten aufgefallen: Die Gender Studies sind in die Mitte der Gesellschaft vorgedrungen. Während der Gender-Star im letzten Jahrzehnt eher im Seminarraum oder der taz anzutreffen war, tritt er nun seinen Siegeszug an. Immer mehr öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten und Politiker*innen drücken durch die Verwendung eines Sternchens aus, mit einer Pluralform eben nicht mehr nur Männer, sondern auch Frauen und sogar jene, die sich keinem Geschlecht zuordnen wollen, anzusprechen. Um diesem Umstand Sorge zu tragen, werden nun sogar schon Begriffe wie „Frau mit Penis“ oder „Person mit Gebärmutter“ verwendet.
Über Jahre hinweg wurde ein Studienfach mit öffentlichen Mitteln aufgepäppelt, das die grundlegenden wissenschaftlichen Kriterien nicht einmal im Ansatz erfüllt.
Während die deutsche Sprache nur das „Geschlecht“ kennt, unterscheidet die englische Sprache zwischem dem biologischen „sex“ und dem kulturellen „gender“. Ihrem Wesen nach untersuchen die gender studies also, wie sehr unsere Geschlechterrollen durch die Gesellschaft geformt werden.
An sich ist an diesem Ansatz nichts auszusetzen. Jedoch reicht es dem gender studies nicht, die kulturellen Geschlechterrollen zu untersuchen und der Medizin den biologischen Aspekt zu überlassen. Stattdessen wird rundheraus geleugnet, es gebe einen solchen biologischen Einfluss überhaupt. So käme beispielsweise die Geschichtswissenschaft niemals auf die Idee, die Geologie abzulehnen. Einen Wissenschaftszweig, der sich auf tausendfache Studien stützt, zur bürgerlichen oder zur Pseudowissenschaft zu erklären, ist selbst unwissenschaftlich.
Zum anderen gibt es in den gender studies kein Falsifikationskriterium, also die Möglichkeit zu überprüfen, ob eine Aussage wahr oder falsch ist.
Der Physiker Jan Hendrik Schön hatte um die Jahrtausendwende bahnbrechende Supraleiter und Transistoren angekündigt. Er hätte damit die gesamte Computerentwicklung auf einen Schlag um zehn, wenn nicht sogar 20 Jahre vorangetrieben. Sogar als Anwärter auf den Nobelpreis wurde Schön gehandelt. Aber Kollegen fielen inhaltliche Widersprüche in seinen Veröffentlichungen auf. Selbst wenn sie den Betrug nicht bemerkt hätten – spätestens dann, wenn Computerhersteller sich auf Schöns Forschungsergebnisse bei der Konstruktion von Mikroprozessoren gestützt hätten, wäre ihnen aufgefallen, dass die Chips eben doch nicht halten, was sie versprechen.
Die gender studies müssen sich jedoch gar nicht erst mit störenden Fakten auseinandersetzen. Dass Deutschland 16 Jahre am Stück von einer Frau regiert wurde, sollte doch eigentlich zeigen, dass wir in keinem Patriarchat leben. Aber wer ein klares Feindbild braucht, der wird darauf verweisen, dass Angela Merkel angeblich nicht die Interessen der Frauen vertrete, oder insgeheim doch nur den Willen der nach wie vor mehrheitlich männlichen Eliten umsetze.
Auch ist an eine ergebnisoffene Diskussion in den gender studies nicht zu denken. Ob das Patriarchat und Sexismus existieren, kann dort wohl kaum debattiert werden. Der mögliche Spielraum ist denkbar klein. So wird man sich allerhöchstens darüber streiten können, ob ein Stern, ein Unterstrich oder ein Doppelpunkt die beste genderneutrale Schreibweise darstellen.
Wohl jeder wird bemerkt haben, dass Männer schneller zum Sex bereit sind als Frauen. Für Feministinnen nur der Beweis dafür, dass das Patriarchat die weibliche Sexualität unterdrückt. Tatsächlich ist die Erklärung eine andere. Eine Frau kann nur einmal im Jahr Nachwuchs zeugen, ein Mann beinahe beliebig oft. Der Energieaufwand einer Schwangerschaft ist ebenfalls ungemein hoch. Daher müssen Frauen eher acht geben, mit wem sie sich binden, während ein Mann evolutionsbiologisch gesprochen viel eher einen Fehler riskieren kann. Der unterschiedliche Sexualtrieb ist in der menschlichen Natur verankert und lässt sich gesellschaftlich nicht beeinflussen.
Auch die viel beschworene toxische Maskulinität, also die höhere Gewaltbereitschaft unter Männern, geht nicht auf das Patriarchat zurück, sondern findet sich ebenso im Tierreich. Zwar kann eine Gesellschaft regulieren, wie oft Morde stattfinden, denn auf der ganzen Welt unterscheiden sich Staaten in ihrer Mordrate. Der Unterschied zwischen Japan und Südafrika beispielsweise könnte kaum größer sein. In beiden Ländern sind es jedoch hauptsächlich Männer, die weniger Skrupel haben zu töten. Eine Gesellschaft, in der in dieser Hinsicht Gleichheit herrscht, gibt es nicht.
Schon unter Neugeborenen zeigen Jungen eher eine Präferenz für Gegenstände und Mädchen für menschliche Gesichter. Aber vermutlich wirkt das Patriarchat schon im Mutterleib. Dass Männer sich mehr für technische Berufe und Frauen eher für Bereiche wie Pflege und Erziehung interessieren, wird wohl kein Girl’s Day dieser Welt ändern können.
Bildquelle:
- Gender_Studies: pixabay