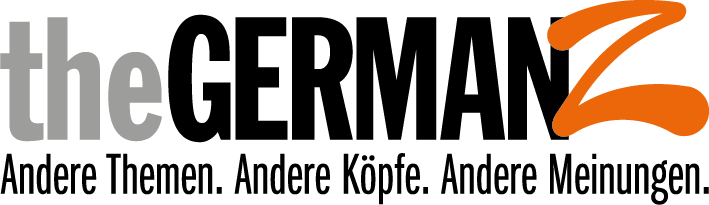von RAINER STENZENBERGER
„Where did you find this beautiful lady?“, wurde ich auf dem Parkplatz eines Sissler Steakhouses von einem älteren Herrn gefragt. Henry, wie er sich kurz darauf vorstellte, zeigte auf meine Frau, mit der ich auf Hochzeitsreise in Richtung Las Vegas unterwegs war. Er schien mir gefühlt 105 Jahre alt zu sein, kam nur gebückt und in Zeitlupe mit einem Stock voran, um an seinem Cadillac ein Päuschen einzulegen und meiner Frau ein Kompliment zu machen. Ein Gesicht mit einer Haut wie ein alter Pferdesattel, aber zwei blitzenden Augen und einem freundlichen Lächeln wie so viele betagte Amerikaner. Wir plauschten ein wenig, erzählten, dass wir aus Berlin stammen, worauf Henry zu einer längeren Geschichte ansetzte. Er war nach Kriegsende als Militärpolizist in Berlin stationiert und lernte bei einem kurzen Trip in den Süden ein deutsches Mädel kennen (er sagte tatsächlich „Mädel“), in das er sich verliebte. Das seien die besten, meinte er, deutsche Frolleins! Ich solle gut auf meine Frau aufpassen. Sagte es und bewegte sich ächzend, aber glücklich in seinen Cadillac, der nur geringfügig kleiner war als ein Flugzeugträger.
Beruflich bedingt war ich häufig in den Vereinigten Staaten, habe dort gelebt und gearbeitet. Charmante Begegnungen wie jene mit Henry gab es so zahlreich, dass ich viele wieder vergessen habe. Die allermeisten Amerikaner haben ein ausgesprochen positives Bild von Deutschland, häufig gespeist von eigenen Erfahrungen, durchaus aber auch von deutschen Erzeugnissen, allen voran Bier, Bratwurst und BMW. Was angesichts vieler öffentlicher Diskussionen oft vergessen wird, ist die große ethnische Gruppe der Deutsch-Amerikaner. Diese Botschafter deutscher Kultur und Tugenden leisten mehr als Politik und Medien – beispielsweise mein alter Freund Ray.
Ich hatte Ray vor fast 30 Jahren kennengelernt, als wir einen Repräsentanten für unser US-Büro suchten. Er war kein Theoretiker, sondern konnte zupacken und verkaufen, genau das, was wir brauchten. Nach einiger Zeit wurde ich vom Chef zum Freund, Ray lud mich mehrfach in sein Haus in einem Vorort Chicagos ein. Er war schon als junger Kerl in den 50er Jahren in die Staaten ausgewandert und hatte dort bei einem Migrantentreffen seine ebenfalls deutsche Frau kennengelernt, mit der er vor einiger Zeit seine Goldene Hochzeit feierte. Sie zogen zwei Kinder groß, für deren Studium er mehrere Hunderttausend Dollar berappen musste. Eine Investition, wie er meinte. Zuhause sprachen die Eltern untereinander ein deutsch-amerikanisches Mischmasch („Honey, gibst Du mir bitte die Sausage?“), mit den Kindern möglichst Deutsch, die antworteten meist auf Englisch. Ray brachte mir das Golfen bei, im Club spielten überwiegend Deutsche, Polen und Italiener („die zwei da hinten am Tisch sind von der Mafia, aber ganz nett.“).
In fast jedem größeren Ort im Mittelwesten wird ein sogenanntes Oktoberfest abgehalten, für Amerikaner das Synonym allerbester, deutscher Kultur: Bier und Würstchen. Häufig treten Sängerinnen mit deutschen Schlagern auf, die ich noch nie gehört habe. Rays Handschuhfach quoll über mit Kassetten superschmalziger, deutscher Interpreten, mir allesamt unbekannt. Wieso ich das schreibe? Es gibt im Mittleren Westen, der als Region solide arbeitender Menschen gibt, Millionen von Rays. Sie verkörpern klassische, in den Staaten hoch angesehene, deutsche Tugenden: Sie sind fleißig, pünktlich, kommen im Business auf den Punkt und können ordentlich trinken. In Wisconsin ist sogar die Mehrheit der Bevölkerung deutscher Herkunft, in anderen Staaten sind es hohe Anteile zwischen 30 und 50 Prozent. Sie tragen wie die amerikanischen Soldaten und Touristen zu einem positiven Deutschlandbild bei – gerade auch, weil sie klassisches Brauchtum pflegen.
Von ganz anderem, noch sehr viel älterem Brauchtum erzählte mir Jameson, genannt Jimmy, ein Indianer vom Stamme der Navajo. Mit ihm ritt ich in einem Abstand von mehr als zehn Jahren zweimal durch das Monument Valley. Dieses fantastisch schöne Hochland mit den aus vielen Westernfilmen bekannten Tafelbergen ist Teil eines Navajo-Reservats. Das Reiten ist dort für Fremde eigentlich untersagt. Jimmy und ich warteten nach dem Frühstück einfach, bis der Sheriff seine übliche Morgenrunde durch das Valley absolvierte (beide rauchten noch gemeinsam eine Zigarette), danach sattelten wir die Pferde und brachen auf. Wir redeten nicht viel, aber Jimmy erzählte mir immerhin, dass er unbedingt einen Mercedes fahren wolle. Die würden aber keine Pick-Ups bauen. Warum nicht? Ich zuckte die Schultern, mir fiel auch kein vernünftiger Grund ein. Jeder Mann liebt doch Pickups! Ich habe leider keinen Kontakt mehr zu Jimmy, aber inzwischen baut Mercedes diese Art Autos und falls ich nochmal in diese Ecke der Staaten kommen sollte, bin ich mir sicher, dass ich den Stern auf einer Kühlerhaube im Monument Valley entdecken werde.
Bevor ich zu Ray zurückkehre, noch kurz zwei weitere Episoden, die den Unterschied zwischen unserem an Vorschriften orientierten Mindset und dem Laissez-faire der Amerikaner amüsant verdeutlichen.
In Florida fuhren wir einmal zu einem Bootsverleih mit gigantisch motorisierten Speedboats. Schließlich habe ich nicht umsonst Miami Vice verschlungen und wollte durch den Golf von Mexico brettern! In vorauseilendem Gehorsam und angesichts fehlender nautischer Erfahrung meinte ich zum Mann hinter dem Schalter: „Aber ich habe keinen Führerschein.“ Der Exilkubaner fragte mich, wie ich denn hierhergekommen sei, und ich zeigte auf den Dodge vor dem Büro, worauf er seufzend den Kopf schüttelte, seine Zigarre weiter zerkaute und brummte: „Dann haben sie doch einen gottverdammten Führerschein.“
In Los Angeles mietete ich einmal einen Chevy, bei dem mir erst kurz vor der Ausfahrt der Mietwagenstation auffiel, dass er einen länglichen Kratzer an der Fahrertür hatte. Recht aufgeregt bat ich den Typ an der Schranke, doch irgendwie zu vermerken, dass das nicht meine Schuld sei und ich bei der Rückkehr keine Scherereien bekäme. Der muskulöse Schwarze zog die Augenbrauen nach oben, lächelte mitleidig und zog die Schranke hoch, mit einem Spruch, der irgendwie nach „It’s just a car, man!“ klang. Ich fuhr durch, stoppte hinter der nächsten Kurve und machte ein Foto vom Kratzer. I’m German!
Eigentlich wollte ich einen eher politisch zentrierten, kurzen Artikel über das deutsch-amerikanische Verhältnis schreiben, z.B. die offenen und klares Interesse dokumentierenden Fragen, die an uns gerichtet wurden, vom General im Pentagon bis zum Gouverneur in Wisconsin. Dann bin ich in der Erinnerung doch an ausgesprochen freundlichen Menschen aus dem Alltagsleben hängengeblieben. „Echten“ Amerikanern und vielen Deutschen, die seit langem in den Staaten leben. Sie transportieren ein positives, wohlwollendes Bild über unser Land, was mich manchmal durchaus beschämt angesichts der Besserwisserei und Kritik, die jeder Hansfranz und jedes Lieschen gerne zu den USA äußert.
Abschließend noch ein kleiner Wermutstropfen: Einen Traum, den ich bei meinem deutsch-amerikanischen Freund Ray kennenlernte, konnte ich mir leider in Deutschland nicht erfüllen: Einen Doppelfernsehsessel made in USA. Zwei dicke, ausklappbare Lederteile, verbunden durch eine Mittelkonsole, in der unten ein Kühlschrank und oben eine Fernbedienung eingebaut war. Ein glattes, kategorisches Verbot meiner Frau („da kommst Du nie wieder raus!“), die mir dafür die Passion für Pickups und Muscle Cars gewährte.
Meine Empfehlung für alle USA-Freunde: Schlendern sie langsam über die Parkplätze und setzen sie sich in Diners an den Tresen. Es dauert nur wenige Minuten, bis sich ein Henry, Jimmy oder Ray für ein Pläuschchen zu ihnen gesellt. Sie werden es genießen.
Bildquelle:
- Straßenschilder_USA: pixabay