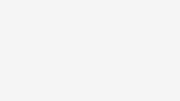von GUIDO VON BIELENBERG
MÜNSTER -In diesen politisch aufgeheizten Zeiten fällt es bürgerliche Menschen immer schwerer, einen eigenen Weg abseits von Extremisten links und rechtszu finden und sich dabei an unverrückbaren Vorbildern zu orientieren.
Wie so häufig, bieten dabei nicht nur der Glaube, sondern sogar immer noch auch die Institution Kirche mit ihrer langen Geschichte Leit- und Vorbilder, an denen man sich orientieren kann. Die Katholiken halten gerade zu diesem Zweck eine Kohorte von Heiligen und Seligen bereit, die durch ihren Lebenswandel, oder aber durch nachträgliche Deutungen ihrer Vita Anhaltspunkte für angemessene Verhaltensweisen erkennen lassen. Heute, am 22. März, ruft sie uns mit Clemens August Kardinal Graf von Galen einen Seligen in Erinnerung, dessen Geradlinigkeit in seiner oppositionellen Haltung zum nationalsozialistischen Regime an seinem Todestag besonders gedacht werden sollte. Der Sproß einer alten westfälischen Adelsfamilie wurde am 16. März 1878 auf der in Familienbesitz befindlichen Wasserburg von Dinklage im Oldenburgischen Münsterland, also dem katholischen Süden des damaligen Großherzogtums Oldenburg (heute Niedersachsen), geboren und verstarb heute vor 76 Jahren in Münster.
Der 22. März ist ein sogenannter „nichtgebotener Gedenktag (memoria ad libitum)“ vornehmlich im Erzbistum Berlin und in den Bistümern Essen und Münster. Dieser in liturgischen Büchern meist mit einem „g“ abgekürzte Tag bezeichnet im geltenden liturgischen Kalender der katholischen Kirche die Feier eines Gedenkens für einen Heiligen, das nach freiem Ermessen in der Messe und im Stundengebet in Gemeinschaft begangen werden kann. Das immer noch katholische Oldenburgische Münsterland gehört kirchenrechtlich mit einer gewissen Autonomie zum Bistum Münster, heute Nordrhein-Westfalen. Am 9. Oktober 2005 wurde Graf von Galen im Petersdom in Anwesenheit von Papst Benedikt XVI. durch den Präfekten der Kongregation für die Kanonisierungsprozesse, Kardinal José Saraiva Martins, seliggesprochen.
Clemens wuchs großbürgerlich auf, als elftes von 13 Kindern des Zentrumsabgeordneten Ferdinand Graf von Galen. Weltläufigkeit war der Familie stets zu eigen, so studierte er Philosophie in Fribourg in der Schweiz, dann Theologie an der Theologischen Fakultät in Innsbruck und im damals preußischen Münster, wo er 1904 zum Priester geweiht wurde. 1906 wurde Galen Kaplan in der Großstadtseelsorge in der Reichshauptstadt. Schon damals bot Berlin genug Gründe, der modernen Gesellschaftsordnung mit Skepsis zu begegnen. Und so äußerte sich Graf von Galen zuweilen auch kritisch über die parlamentarische Demokratie der Weimarer Republik und war aktiv im konservativen Flügel der Zentrumspartei.
1919 wurde er Pfarrer in Schöneberg, das 1920 nach Berlin eingemeindet wurde, und 1929 Pfarrer in Münster. 1933, im Jahr der Machtergreifung durch die Nazis, wurde er von Papst Pius XI. zum Bischof von Münster ernannt. Sein entschiedener und öffentlicher Widerstand gegen die kirchenfeindliche Politik und die Rassenlehre der Nationalsozialisten ließ nicht lange auf sich warten. 1937 sorgte er für die Verbreitung der päpstlichen Enzyklika „Mit brennender Sorge“, in der das NS-Regime und dessen Kirchen- und Rassenpolitik scharf verurteilt wurden. 1941 hielt Galen drei legendär gewordene Predigten, in denen er die Beschlagnahmung von Kirchengütern und die Euthanasiemaßnahmen der Nationalsozialisten scharf anprangerte. Nachschriften wurden – illegal und unter der Hand – in ganz Deutschland verbreitet. Aufgrund seiner mutigen Kritik erwarb er sich die volkstümliche Bezeichnung „Löwe von Münster“ und wurde so auch im Ausland bekannt. Einer Verhaftung entging Galen, weil die Nazis um die Loyalität von Katholiken und der ansonsten konservativen Oldenburger und Münsterländer fürchtete.
Nach dem Zweiten Weltkrieg kritisierte Graf von Galen auch die Willkür der Besatzungsmächte, was ihm die Gegnerschaft der britischen Militärverwaltung einbrachte. 1946 wurde er in Rom zum Kardinal erhoben, kurz nach seiner Rückkehr starb er in Münster. Keine Angst zu haben sich auch mit mächtigen Gegnern anzulegen, dabei seinen Überzeugungen und seinem Glauben treu zu bleiben, ist die wesentliche Lehre aus dem Wirken und Schaffen dieses seligen und vorbildlichen Kirchenmannes.
Selbstverständlich boten die ebenfalls mächtige Institution Kirche und der Heilige Stuhl einen gewissen Schutz. Dennoch waren ganze evangelische Landeskirchen der ersten deutschen Diktatur verfallen, so dass die klare Haltung von Galens ein besonderes Gewicht gewann.
In seiner Predigt vom 3. August 1941 prangert von Galen die Euthanasie, d. h. die Ermordung von Geisteskranken an:
„Man urteilt: Sie können nicht mehr Güter produzieren, sie sind wie eine alte Maschine, die nicht mehr läuft, sie sind wie ein altes Pferd, das unheilbar lahm geworden ist, sie sind wie eine Kuh, die keine Milch mehr gibt. Was tut man mit solch alter Maschine? Sie wird verschrottet. Was tut man mit einem lahmen Pferd, mit solch einem unproduktiven Stück Vieh? Nein, ich will den Vergleich nicht bis zu Ende führen (…)
Wenn man „unproduktive Mitmenschen“ töten darf, dann wehe uns allen, wenn wir alt und altersschwach werden! Wenn man die unproduktiven Mitmenschen töten darf, dann wehe den Invaliden, die im Produktionsprozess ihre Kraft, ihre gesunden Knochen eingesetzt, geopfert und eingebüsst haben! Wenn man die unproduktiven Mitmenschen gewaltsam beseitigen darf, dann wehe unseren braven Soldaten, die als schwer Kriegsverletzte, als Krüppel, zurückkehren.
Wenn einmal zugegeben wird, dass Menschen das Recht haben, unproduktive Mitmenschen zu töten, und wenn es jetzt zunächst auch nur arme, wehrlose Geisteskranke trifft, dann ist grundsätzlich der Mord an allen unproduktiven Menschen, also an den unheilbar Kranken, den arbeitsunfähigen Krüppeln, den Invaliden der Arbeit und des Krieges, dann ist der Mord an uns allen, wenn wir alt und altersschwach und damit unproduktiv werden, freigegeben.“
(Quelle: http://www.galen-archiv.de/index.php?option=com_content…)
Als 2005 nach langem Vorlauf die Seligsprechung Clemens August Kardinal Graf von Galens in Rom anstand, war der damalige niedersächsische Ministerpräsident Christian Wulff (CDU), selbst Katholik aus Osnabrück, der niedersächsischen Nachbarstadt Münsters, nach Rom eingeladen worden um an der Seligsprechung teilzunehmen. Wulff sagte ab, aus Zeitgründen. Im Landeskabinett wurde der Termin hin und her geschoben bis man sich schließlich entschied, den aus Oldenburg stammenden evangelischen Wissenschafts- und Kulturminister und Parteifreund (aber Wulff-Intimfeind) Lutz Stratmann in den Vatikan zu entsenden. 2007 standen Landtagswahlen an und etwa die Hälfte der knapp acht Millionen Niedersachsen gehörte damals noch der Evangelischen Kirche an. Etwa zwei Millionen Menschen, also etwas mehr als ein Viertel, bekannten sich zu keiner öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaft. Und nur weniger als ein Fünftel (18,3 %) der Bevölkerung war katholisch (1,4 Millionen). Ob also Wulff, der sich 2005 bereits von seiner damaligen Ehefrau getrennt hatte und sich 2006 erstmals mit seiner späteren Ehefrau Bettina Körner öffentlich sehen ließ, in Rom nicht zu katholisch wirken wollte, ist nicht überliefert, wurde aber in Hannover damals durchaus auf den Fluren geflüstert.
Bildquelle:
- Clemens August Kardinal von Galen: bistum münster/albers