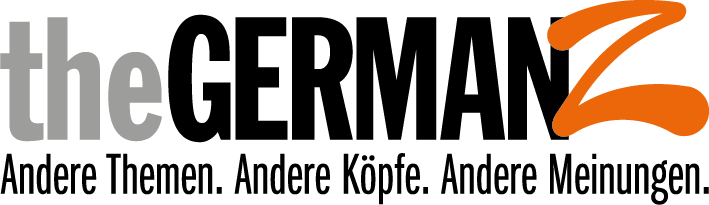Tunis – In einem schmucklosen Zimmer in einer kleinen Stadt in den tunesischen Bergen hat sich die Familie des Berlin-Attentäters um einen niedrigen Tisch versammelt. Der kalte Wind weht durch die offene Tür, durch die pausenlos Nachbarn kommen. Alle fünf Schwestern sind da, zwei seiner Brüder, die Mutter mit den Berbertätowierungen im Gesicht, der alte Vater, der die linke Hand reicht, weil ihm der rechte Arm fehlt. Auf dem Tisch steht ein Bild von Anis, dem Jüngsten von insgesamt neun Geschwistern.
«Ich kann es gar nicht glauben, dass Anis so etwas gemacht haben soll», sagt die 28-jährige Schwester Najwa. Er habe doch noch am Sonntag angerufen. Einen Tag, bevor er in Berlin einen Lkw in einen Weihnachtsmarkt gesteuert und mindestens zwölf Menschen getötet haben soll.
«Wir können es alle nicht glauben», sagt die Schwester, die mit Kopftuch und im Trainingsanzug in dem kleinen Zimmer sitzt. «Anis war nie religiös. Er hat getrunken, er hat gefeiert, er hat Popmusik gehört.» Er sei ein ganz normaler Junge gewesen.
Zusammen mit vier anderen Jungs aus dem Viertel macht Anis Amri sich den Erzählungen seiner Familie zufolge im März 2011 auf den Weg über das Mittelmeer. Der Arabische Frühling ist gerade erst drei Monate alt. «Wir haben alle nicht damit gerechnet, dass sich irgendwas hier ändert», erzählt die Schwester Najwa. Die Familie habe das Geld für den Schlepper von der Küstenstadt Sfax Richtung Italien zusammengekratzt, damit er es schafft. Anis ist damals 17 Jahre alt und ihm droht eine mehrjährige Haftstrafe wegen Diebstahls. Er soll einen Lkw geklaut haben, so die Anklage.
Zehntausende brechen damals an der tunesischen Küste auf. Viele kommen aus ähnlichen Verhältnissen wie Anis, aus kleinen Dörfern wie der 8000-Einwohner Stadt Oueslatia, wo die Straßen staubig sind, die Häuser niedrig und die Zukunft ungewiss. Sie hoffen auf ein besseres Leben in Europa. Für Anis Amri endet die Reise zunächst in einem Flüchtlingslager in Italien, dann folgen mehrere Jahre Haft in Italien, wie die Familie berichtet.
In dieser Zeit muss Amri radikalisiert worden sein, vermutet der Professor für Zeitgeschichte und Experte für Dschihadismus, Alaya Allani, von der Manouba Universität in der tunesischen Hauptstadt Tunis. «Er war jung und kam aus einer armen Familie, die Eltern waren getrennt, er hat die Schule nach acht Jahren verlassen», sagt Allani. «Seine Radikalisierung steht im Zusammenhang mit seiner sozio-ökonomischen Situation».
Zwar gilt Tunesien weltweit als einer der größten Exporteure von Kämpfern für den Islamischen Staat (IS) – Amerikanische Denkfabriken schätzen, dass bis zu 7000 Tunesier aufseiten der Terrormiliz in Syrien, im Irak und Libyen kämpfen – aber die große Radikalisierungswelle habe erst in den Jahren nach der Revolution, zwischen 2011 und 2014 stattgefunden. Da war Anis Amri in Italien in Haft.
Als er aus der Haft entlassen wird, die italienischen Behörden ihn aber nicht abschieben können, reist er nach Deutschland weiter. Er habe regelmäßig angerufen oder Nachrichten über Facebook geschrieben, erzählt seine Schwester Najwa. Einmal habe er auch ein Paket geschickt: Ein Handy und Schokolade. «Aber es war schwer für ihn. Er kam nicht gut zurecht, er wollte zurück nach Tunesien, das hat er in jedem Telefonat gesagt.»
Er habe sogar einen Anwalt eingeschaltet, damit seine drohende Haftstrafe aus der Jugend ausgesetzt wird. Die Mutter holt ein Schreiben vom 9. September diesen Jahres hervor: Ein Zeuge widerruft darin eine frühere Aussage, in der er Anis belastet hatte. Die Familie nimmt ernst, dass ihr Junge wirklich zurückkommen will und versucht alles, ihm zu helfen.
«Was ich nicht verstehe», sagt Najwa: «Wenn Anis wirklich so gefährlich war und observiert wurde, warum hat man ihn nicht festgenommen?» Die Frage schwebt unbeantwortet im Raum. Ein paar Wochen nachdem Anis in Deutschland ankommt, schickt er den Schwestern ein Foto: Er mit einer jungen blonden Frau im Arm. «Seine Freundin», habe er gesagt. Für die Familie wäre das in Ordnung gewesen. So wie es für ihn egal gewesen sei, ob seine Schwestern Kopftuch tragen oder nicht.
«Ich will nur, dass die Wahrheit herauskommt», sagt Anis Mutter Nur el-Houda. Sie weint die ganze Zeit mit den Schwestern: um den Sohn, weil sie das Schlimmste befürchtet. «Wir beten mit den Opfern, so oder so.»
Bildquelle:
- Anis Amri: dpa