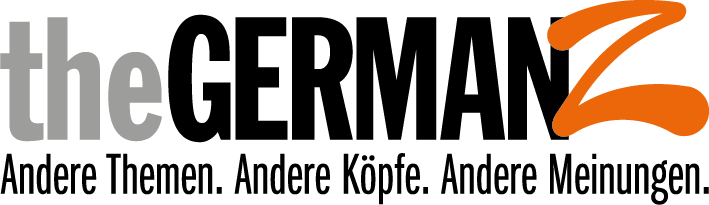von MARTINA HERZOG
Luxemburg – Religion ist Privatsache – eigentlich. Aber was, wenn jemand am Arbeitsplatz deutlich sichtbar religiöse Symbole trägt? An diesem Dienstag will der Europäische Gerichtshof in Luxemburg zwei wegweisende Urteile zum Kopftuch am Arbeitsplatz sprechen. Auslöser sind zwei Fälle in Belgien und Frankreich.
Worum geht es im belgischen Fall?
Drei Jahre lang arbeitete Samira A. als Rezeptionistin in einem belgischen Sicherheitsunternehmen. Im April 2006 kündigte sie an, sie werde ihr Kopftuch künftig auch während der Arbeitszeit tragen, statt wie bisher nur in der Freizeit. Das widersprach aber der internen Arbeitsordnung: «Es ist den Arbeitnehmern verboten, am Arbeitsplatz sichtbare Zeichen ihrer politischen, philosophischen oder religiösen Überzeugungen zu tragen und/oder jeden Ritus, der sich daraus ergibt, zum Ausdruck zu bringen», stand dort. Wenig später wurde A. mit einer Abfindung entlassen – und zog vor Gericht.
Und bei der Muslimin aus Frankreich?
Asma B. arbeitete seit Juli 2008 als Software-Designerin bei einem französischen Unternehmen. Kaum ein Jahr später verlor sie den Job. Der Grund: Ein Kunde in Toulouse hatte sich beklagt, weil B. dort mit Kopftuch arbeitete. Das Unternehmen bat darum, dass es «nächstes Mal keinen Schleier» geben möge. B. bestand im Gespräch mit ihrem Arbeitgeber aber auf dem Tragen des Kopftuchs. Es kam zur Entlassung und B. klagte wegen Diskriminierung.
Welche Fragen sind für das Urteil relevant?
Die Richter dürften zwei Formen möglicher Benachteiligung abklopfen. Bei unmittelbarer Diskriminierung wird jemand etwa wegen seiner Religion schlechter behandelt, was verboten ist. Bei mittelbarer Diskriminierung ist das weniger eindeutig. Dabei benachteiligen scheinbar neutrale Vorschriften bestimmte Personen. Das Verbot einer Kopfbedeckung am Arbeitsplatz würde zum Beispiel jüdische Männer mit einer Kippa treffen, männliche Sikhs, die einen Turban tragen – oder eben muslimische Frauen mit einem Kopftuch. Für solche Verbote muss es laut EU-Richtlinie gute Gründe geben. Denkbar wären zum Beispiel Hygiene oder Arbeitsschutz.
Welche Chancen haben die Klägerinnen?
Tendenziell folgen die Richter den Empfehlungen ihrer Gutachter. Doch die beiden sogenannten Generalanwältinnen haben hier ziemlich unterschiedlich argumentiert. Juliane Kokott kommt im Fall A. zu klaren Ergebnissen: Ihr Unternehmen will weltanschaulich neutral sein. Eine unmittelbare Diskriminierung aus religiösen Gründen sei das nicht.
Das sieht Gutachterin Eleanor Sharpston bei B. ganz anders: Ein Verbot religiöser Zeichen beim Kundenkontakt sei eine unmittelbare Diskriminierung – und auch eine mittelbare. Eine von Arbeitnehmern empfundene religiöse Pflicht sei eben nicht gleichzusetzen mit dem Tragen von Fußball-Fanshirts oder Uni-Krawatten. «Wenn sie ihren religiösen Überzeugungen treu bleiben wollen, haben sie keine andere Wahl, als gegen die Regelung zu verstoßen und die Konsequenzen zu tragen», schreibt sie.
Eine mittelbare Diskriminierung kann aus Sicht beider Gutachterinnen gerechtfertigt sein. Relevant seien besonders Größe und Auffälligkeit des religiösen Zeichens, die Art der Tätigkeit und ihr Kontext und die nationale Identität des Landes, meint Kokott.
Ist jede Art von Ungleichbehandlung im Beruf verboten?
Nein. Zwar ist Diskriminierung wegen Religion oder Weltanschauung, Behinderung, Alter oder sexueller Ausrichtung laut EU-Richtlinie untersagt. Aber nicht jede Ungleichbehandlung muss diskriminierend sein. Arbeitgeber können zum Beispiel unter bestimmten Umständen Vorgaben zum Alter machen.
Wie ist die Rechtslage in Deutschland?
«Frauen dürfen am Arbeitsplatz ein Kopftuch tragen», sagt die Anwältin Doris-Maria Schuster, die in derartigen Fällen mehrmals Arbeitgeber beraten hat. Aber generelle Verbote, die auch solche Symbole treffen können, sind möglich. Gründe könnten etwa die Sicherheit am Arbeitsplatz, eine Störung des Betriebsfriedens oder eine drohende Geschäftsschädigung durch nachweisbare Beschwerden von Kunden sein.
Viele Streitfälle in Deutschland drehten sich bisher allerdings um öffentliche oder religiöse Arbeitgeber, die nicht in jeder Hinsicht mit privatwirtschaftlichen Unternehmen gleichzusetzen sind.
Könnte sich daran etwas ändern mit den Urteilen?
Die obersten Richter der Europäischen Union geben nationalen Gerichten die Richtung vor. Wenn sich bei Klagen vor deutschen Gerichten die gleichen Rechtsfragen stellen wie nun vor dem EuGH, dann müssen die Richter sich an die Luxemburger Auslegung des europäischen Anti-Diskriminierungsverbots halten. Das heißt, Kopftuchverbote am Arbeitsplatz müssten dann den Voraussetzungen entsprechen, die der EuGH festlegt.
Bildquelle:
- Kopftuch: dpa