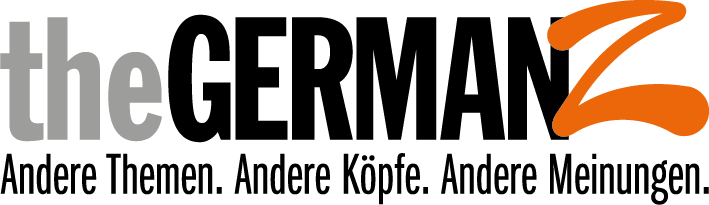von MARK ZELLER
HAMBURG – Mit seinem neuen Werk nähert sich Jan Delay seinen musikalischen Wurzeln. Zwar ist „Earth, Wind & Feiern“ weder das erwartete Durchtanz-Album, noch enthält es einen herausstechenden Ohrwurm. Aber in seinem vielfältigen Genremix birgt es manch‘ interessante Sound-Perle.
Die schlechte Nachricht vorneweg: Wer sich von Titel und Cover angesprochen fühlt, wird vom Inhalt wahrscheinlich enttäuscht. Die gute Nachricht: Es gibt trotzdem einigen Groove – in abwechslungsreichen Varianten. Das neue Werk „Earth, Wind & Feiern“ von Klangtüftler Jan Delay orientiert sich eher wenig am Partymusikstil der US Kult-Band, die Namenspate stand. Dafür zeigt sich der Hamburger Hip-Hop-Styler mit seinem fünften Soloalbum unter Zuhilfenahme diverser Gastkünstler äußerst vielgestaltig.
Sieben Jahre „nach der Rockplatte, auf die keiner Bock hatte“ geht er gleich im Intro auf selbstironische Distanz zu seinem letzten Solowerk „Hammer & Michel“ und kündigt stattdessen „neuen dicken Sound“ an. Und der klingt wieder deutlich mehr nach dem alten Delay. Er näselt und quäkt sich durch 43:42 Minuten voller gediegener Bässe und Bläsersätze, Funk- Reggae-, Dub- und Ska-Elemente, irgendwo zwischen „Daft Punk“, „Capital Bra“ und „Culcha Candela“.
Auf dem Album spiegeln sich die Alltagsprobleme eines Mittvierzigers in Pandemie-Zeiten. Allerdings scheint es, wie sein Interpret, nicht genau zu wissen, wo es hin will: Feiern wie früher, chillen im Jetzt und hier, dazu ein bisschen schablonenhafte Gesellschaftskritik auf dem Niveau einer Schüler-Vertretung vor 25 Jahren. Das alles in buntem Genre-Mix.
Los geht’s mit besagtem „Intro“: „Lass uns die Wolken vertreiben. Ich hab‘ Sonne dabei.“ Ein Breakbeat-Einstieg mit froher Verheißung: „Earth Wind und Feiern – und alles wird gut.“ Mit „Eule“ gibt’s gleich darauf eine treibende Funky Beat-Nummer mit Radiopotential, die ziemlich an „Get Lucky“ erinnert. Zusammen mit Rapper „Marteria“ ergeht er sich hier in der Sehnsucht, endlich mal wieder Nachteule sein zu können. Etwas, was als junger Vater und unter Corona-Auflagen nicht ganz einfach ist. Ein Song, der nicht zuletzt deshalb den Nerv seiner mit ihm älter werdenden Fan-Gemeinde ziemlich genau treffen dürfte.
Das anschließende „Klingmeinding“ (feat. „Summer Cem“) hingegen ist eher ein Zugeständnis an die offenbar wachsende „Babo“-Fraktion und hat einiges von „Hamma“. Stilbrüchig weiter geht es mit „Alexa“, einer Dub-Ballade, die mit Bezug auf den bekannten Sprachassistenten die komplexe neue Welt reflektiert. „Alexa, bitte regel‘ mein Leben!“ – eine (selbst)ironische Zustandsbeschreibung als Offenbarungseid der gesellschaftlichen Entwicklung.
Weiter geht’s mit „Spaß“ (feat. Denyo) – leider nur vom Titel her. Denn die haarsträubenden Belehrungs-Attitüden im seichten Funk-Gewand („exotische Aromen sind nicht arisch“) verraten mehr über die Vorurteilswelt besser gestellter hanseatischer Haltungs-Hipster, als über die von ihnen adressierten „Besorgtbürger“. „Sie hatten alle noch nie Spaß. Und darum sind sie voller Hass.“ – so einfach ist das im Delay-Kosmos. Das reißt auch kein griffiger Groove mehr raus.
Das Stück „Zurück“ liefert nachdenkliche Latino-Klänge, gut tauglich für einen gepflegten Sonnenuntergang am Meer. Wobei Delay spätestens hier nicht mehr nur stimmlich klingt wie Til Schweiger nach einer durchjammerten Nacht an der Hotelbar. Die Entschuldigung folgt prompt in „Gestern“, wo es heißt: „Tut mir leid, liebe Brüder und Schwestern. Nichts ist so kalt wie der heiße Scheiß von gestern.“ Klingt griffig, aber auch etwas widersinnig, weil doch das Album selbst an vielen Stellen ziemlich dolle „retro“ klingt. Was aber auch gar nicht schlecht ist.
Das darauffolgende „Tür’n knall’n“ (feat. „Lary“) ist trotz seines Titels eine eher chillig-gediegene, gleichwohl eckig-tanzbare Nummer mit ins emotional Schwarze treffendem Herzschmerz-Text. Im Bläser-dominierten „Lächeln“ wiederum gibt es witzige Sozialschelte inklusive Frauen-Chor-Anleihen bei Peter Foxs „Haus am See“. Mit „Saxophon“ wiederum liefert Delay eine lupenreinen „Ska“-Song, in dem er seine Jugend als „Hippie-Kind“ im „Bonzenviertel“ reflektiert.
Als „Wassermann“ outet sich der Künstler im vielleicht stärksten Song des Albums, einem Hohelied auf das nasse Element in entspanntem Reggae. „Also wenn ihr mich sucht, ich bin am Wasser, Mann. Genieße die Aussicht, und glaub, ich werd‘ nie wieder traurig.“ Welch’ herrliche Vision! Den würdigen Schlussakt bildet „nich’ nach Hause“, in dem nicht nur inhaltlich dunkel wieder zu hell wird, sondern auch musikalisch Reggae zu Ska. „„Hier bin ich richtig… fühlt sich gut an… Ich will noch nich’ Hause. Da wartet die Realität.“ Eine bittersüße wie treffende Beschreibung einer krachenden Partynacht, wie sie wohl jeder kennt.
Wie hier, ist Delay insgesamt immer dann am stärksten, wenn er den einseitigen Weltverbesserer weglässt und sich stattdessen im Persönlichen, im Alltäglichen bewegt, dabei besondere Momente gut einfängt und dazu bringt, dass sie im Kopf des Hörers hängenbleiben. Was allerdings weniger hängen bleibt, sind jene Melodien, die besonders eingängig wären. Bei allen bunten Einflüssen fehlt es dem Album an Hitpotential. Es fehlt der Ohrwurm.
Für die Zufriedenheit seiner Fans reicht’s allemal, wie auch der Einstieg auf Platz Drei der Deutschen Album-Charts verrät. Für einen schmissigen Untermalungssound an sonnigen Tagen auch. Für ’ne fette Non-Stop-Party eher weniger. Fazit: Mit Blick auf sein Gesamtwerk ist Jan Delays neuestes Erzeugnis, um im Wording des Meisters selbst zu bleiben, eher so „geht so“. Das aber immerhin mit einigen spannenden Klangmomenten.
Bildquelle:
- 01694719.000000: people image