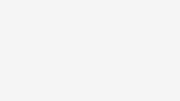von MINA BUTS
Von den „Belgern“ berichtet Caesar in seinem „Gallischen Krieg“, dass sie die tapfersten unter allen gallischen Stämmen waren. Jahrhundertelang blieb verborgen, was mit ihnen geschehen war, bis 1831 ein Kunststaat namens „Belgien“ als Puffer zwischen französischen und englischen Interessen entstand. Die Bewohner Belgiens konnten sich aber im Gegensatz zu den tapferen Galliern untereinander nicht verständigen, sie hatten keine gemeinsame Geschichte geschweige denn ein gemeinsames Interesse. Der Streit unter ihnen eskalierte im Ersten Weltkrieg – überhebliche wallonische Offiziere verheizten flämische Mannschaftsdienstgrade zu Tausenden. Jahrzehntelange und bis heute andauernde Auseinandersetzungen waren die Folge.
Belgien ist in der Tat ein gewagtes Konstrukt: Es gibt neben der flämischen und wallonischen auch eine Brüsseler Region. Es gibt – nicht analog zu den Regionen – mit Niederländisch, Französisch und Deutsch drei offizielle Landessprachen. Dazu kommen sechs Parlamente: Eins für Flandern, eins für Wallonien, eins für Brüssel, eins für Wallobrux, eins für die deutsche Minderheit und eins für ganz Belgien. Seit den sechziger Jahren ist die Föderalisierung des Landes in bislang sechs Stufen vorangetrieben worden – dem inneren Frieden im Land hat das allerdings bislang nicht genutzt. Auch nahezu 200 Jahre nach dem Entstehen des Staates gibt es keine „Mischehen“ zwischen Flamen und Wallonen, es gibt keine ideologische Verbindung zwischen den eher konservativ-rechten Flamen und den links-sozialistischen Wallonen, es gibt nicht einmal eine Partei, die die Interessen ganz Belgiens vertritt. Und hätten die „Roten Teufel“ bei der letzten Fußball-WM nicht fast das Finale erreicht, gäbe es nicht das wahrhaft burgundische Essen und die trotz ihres Alters noch ganz nett anzusehende Königin Mathilde, so fände sich nichts, was eine „belgische Identität“ begründen könnte.
Doch welch glückliche Fügung – nach dem Ende des Ersten Weltkriegs wurde ein kleiner Gebietsstreifen, gerade mal 854 Quadratkilometer groß, von Deutschland abgetrennt und Belgien zugeschlagen. Hier wohnen die einzig echten Belgier, die sich jedem ungeniert und ungefragt als Belgier vorstellen und doch nur deutsch sprechen können.
Damals, 1919, hätten die Bewohner von Eupen, Malmedy und St. Vith in einer Volksabstimmung für den Verbleib im Reich votieren können. Doch dank der „petit farce belge“ konnte sich nur eintragen, wer in Eupen oder Malmedy wohnte und bereit war, seinen Namen öffentlich zu machen. Gerade mal 271 Deutsche hatten den Mut dazu, im Dezember 1920 erklärte der Völkerbund, damit sei ein eindeutiges pro-belgisches Votum erfolgt.
Zwar waren die ersten Jahrzehnte waren von großem Mißtrauen gegenüber den Neubürgern geprägt, doch 1962 wendete sich das Blatt schlagartig, als sie als „deutsche Gemeinschaft“ anerkannt wurde. Seither dürfen die 77.000 Deutschbelgier, die gerade mal 0,68 Prozent der Bevölkerung Belgiens ausmachen, ein eigenes Parlament mit 24 Mandatsträgern wählen, ihre Regierung besteht aus vier Personen. Sie profitieren von den vielen Staatsreformen, mit denen das einst zentralistische Belgien in einen föderalen Staat umgewandelt wurde, und dürfen nun selbst über Bildung, Schule, Kindergarten, Tourismus und auch Teile des Gesundheitswesens entscheiden. Im Gegensatz zu Flamen und Wallonen lieben sie ihr Land: 97 Prozent finden Belgien toll, zwei Drittel bezeichnen sich sogar als königstreu.
Wie „belgizistisch“ und gleichzeitig antideutsch die deutsche Minderheit in Belgien tickt, wurde bei der Regierungskrise 2010/2011 klar. Über 541 Tage gelang keine Regierungsbildung, die belgische Teilung war zum Greifen nah. Die Flamen gaben sich damals selbstbewußt: Mit 6,5 Millionen Einwohnern und einer unglaublichen Wirtschaftskraft seien sie jederzeit imstande, auch einen eigenen flämischen Staat zu gründen. Die Wallonen klopften hingegen in Paris an und verhandelten mit dem Außenministerium, ob nicht nordöstlich von Nord-Pas-De-Calais ein weiteres Departement Frankreichs entstehen könne. Die deutsche Minderheit – nicht in der Lage als selbständiger Staat zu existieren – fragte aber eben nicht bei der Bundesregierung an, sondern wandte sich an den Großherzog von Luxemburg mit der Bitte um Aufnahme im Fall einer Landesspaltung.
Heute sieht sich die deutsche Gemeinschaft als Modellregion Europas: 2019 wurde hier der erste europäische „Bürgerrat“ installiert. 24 Personen, durch Los ermittelt, stehen als „Beratungsgremium“ bereit und versuchen, bürgernahe Politik zu machen. Das gleichstarke Parlament ist verpflichtet, sich zumindest die Vorschläge des Gremiums anzuhören und kann diese auch umsetzen. Mit der Kampagne „Made in Ostbelgien“, begonnen im März, will Ministerpräsident Oliver Paasch das Belgische seiner Region nun noch besser vermarkten.
Bildquelle:
- Belgien_Brügge: pixabay