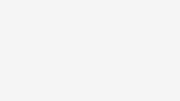von MARTIN D. WIND
BERLIN – Es ist zwar ein Jahrestag, aber kein Grund zum Feiern: Am 26. April 1986 kam es im Block 4 des Kernkraftwerks Tschernobyl in der Ukraine zu einem schweren Unfall. Noch heute muss die deutsche Gesellschaft mit den Folgen dieser Havarie leben: Die Angst vor der friedlichen Nutzung der Kernenergie wurde angeheizt und hat auch dazu beigetragen, in Deutschland den Weg zur sogenannten Energiewende zu ebenen. Aber auch im Kleinen gibt es noch immer Dinge zu beachten, die unmittelbar und persönlich betreffen können: Radioaktivität in Lebensmitteln.
So meldet beispielsweise der Bayerische Jagdverband, dass noch immer Wildschweine erlegt werden, die erhöhte Strahlenwerte aufweisen – und das 35 Jahre nach dem katastrophalen Unglück. Damals waren in den zehn Tagen, die der Reaktor ohne jegliche Schutzhülle gegen das Austreten radioaktiver Stoffe brannte, mehrere Trillionen Becquerel kilometerhoch in die Atmosphäre aufgestiegen und durch Winddrift über Ost- und Mitteleuropa verteilt worden. Besonders betroffen waren von der Ausbreitung der eher leicht flüchtigen Stoffe – Tellur, Cäsium und Jod – in Deutschland, Gebiete in Bayern: Schwaben, Oberfranken, Oberpfalz und der Bayerische Wald.
Obwohl Cäsium eine Halbwertszeit von „nur“ 30 Jahren aufweist – im Gegensatz zu beispielsweise Plutonium mit mehreren 1000 Jahren – lagert dieser radioaktive Fallout noch immer in unterschiedlichen Konzentrationen im Boden – je nach Beschaffenheit des Untergrunds. Wildschweine nehmen diese strahlenden Partikel mit ihrer Nahrung auf: Pilzen Wurzeln, Engerlingen und anderen Kleinlebewesen, die sie aus dem Boden mit ihrem Rüssel herausbrechen. Von der Wissenschaft wurde festgelegt, dass Wildbret mit einer Strahlenlast von mehr als 600 Becquerels Cäsium nicht in den Verkehr gebracht werden darf und nicht verzehrt werden soll.
Der Bayerische Jagdverband stellt die Einhaltung dieser Vorschrift sicher. Er hat im Freistaat 124 Messtationen eingerichtet und mit entsprechenden Geräten zur Überprüfung der Belastung ausgestattet. So können die Verbraucher sicher sein, dass sie keiner überhöhten Belastung ausgesetzt sind, wenn sie sich dieses qualitativ wertvolle und reinbiologische Fleisch direkt aus der Natur gönnen. Allerdings sollte man auch vorsichtig mit der Beilage sein.
Gerade Pilze nehmen strahlende Partikel aus dem Boden auf und lagern sie im Fruchtkörper an. Auch hier gilt – eigentlich – die 600 Becquerel-Regel. Doch wie soll man das überprüfen, wenn man selbst „in den Pilzen“ war und eine große Beute mit nach Hause brachte. Da können – je nach Region – pro Kilogramm Frischmasse mehrere tausend Becquerel erreicht werden. Besonders betroffen sind heute noch Gegenden in Südbayern und der bayerische Wald. Hier sind Semmelstoppelpilze, Maronenröhrlinge oder Gelbstielige Trompetenpfifferlinge die Sorgenkinder der Wissenschaft. Bedenklich sind auch saisonale und offenbar wetterabhängige Schwankungen der Belastungen.
Genau ist man diesen Mechanismen allerdings noch nicht auf die Spur gekommen. Das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) empfiehlt für Pilze eine Verzehrmenge von nicht mehr als 250 gr. pro Woche pro Person. Dann allerdings sei die Pilzmahlzeit oder -beilage unbedenklich. Pilze aus dem Handel gelten wegen der Lebensmittelkontrollen als vollkommen unbedenklich – auch wenn sie aus den östlichen Anrainerstaaten Deutschland stammen. Um die Strahlenbelastung darzustellen, schreibt das BfS auf seiner Homepage: „Der Verzehr von 200 Gramm Pilzen mit 3.000 Becquerel Cäsium-137 pro Kilogramm hat eine Belastung von 0,008 Millisievert zur Folge. Dies entspricht der Strahlenbelastung bei einem Flug von Frankfurt nach Gran Canaria.“
Es gibt zwar die Möglichkeit, auch Pilze untersuchen zu lassen. Dafür müssen aber 250 Gramm des wertvollen Fundes „geopfert“ werden. Das wäre dann in einigen Gebieten mit Sammelbeschränkung schon beinahe die Menge, die man pro Person höchstens aus dem Wald mitnehmen darf. Darüber hinaus wird bei der Bestimmung der Belastung von Pilzen, das Lebensmittel zerstört und die Messmöglichkeiten sind nicht so engmaschig wie für Wildbret. Am besten erkundigt man sich via Internetsuche über die Messwerte im bevorzugten „Jagdrevier“ oder aber man versucht von den zertifizierten Pilzberatern Auskunft zu erlangen. Trotz aller Belastungen: Lassen Sie es sich schmecken!
Bildquelle:
- Reaktor_Tschernobyl: thegermanz