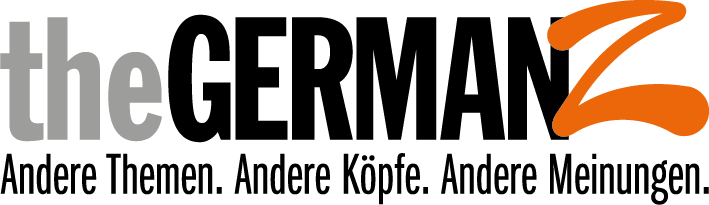Liebe Leserinnen und Leser,
in den vergangenen Tagen habe ich auch hier mehrfach vom Krieg geschrieben. Nicht weil ich krieg irgendwie faszinierend finde, sondern weil die Nachrichten aus Südostasien und von der Grenzregion zwischen Weißrussland und Polen unvermeidlich machen, sich damit zu beschäftigen, wenn man eine Tageszeitung betreibt.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat gestern, am Volkstrauertag, gefordert, dass sich unsere Gesellschaft endlich mit ihrer Armee, der Bundeswehr, auseinandersetzt. Denn das sind unsere Söhne und Töchter, die da dienen, die uns beschützen sollen im Ernstfall sogar unter Einsatz von Leib und Leben.
90.000 Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr haben in den vergangenen 20 Jahren am Hindukusch unsere Freiheit verteidigt, wie der ehemalige Verteidigungsminister Peter Struck von der SPD das formulierte. Diese Soldaten sind nicht gefragt worden, ob sie das wollen. Sie haben einen Marschbefehl bekommen und ihren Rucksack gepackt. Das ist das Wesen des Soldatenlebens. Ich kenne ein oder zwei Dutzend dieser großartigen jungen Menschen und natürlich auch ein paar Ehemalige, die in meinem Alter sind. Wenn ich mit ihnen spreche, auch mal beim Bier, dann liegt da etwas in der Luft, was wir sonst kaum noch erleben. Klar wollen auch unsere Soldaten ein vernünftiges Gehalt, Freizeit, Gefahrenzulage, all das, was jeder will, der einen anstrengenden und gefährlichen Job macht.
Aber Soldat oder auch Polizist zu sein, das ist etwas anderes. In Leipzig hatte ich mal nach einer Lesung, wo ich mein Buch „Bürgerlich, christlich sucht…“ vorstellte, im Anschluss ein kurzes Gespräch mit einer Soldatin, die mich ansprach. Sie erzählte mir, wie gern sie ihren Dienst versehe, wie stolz sie darauf ist, ihrem Land dienen zu dürfen. Und wie schroff sie im Alltag oft Ablehnung erlebt von den Leuten, die sie im Ernstfall beschützen soll. Einmal sei sie auf einem Bahnsteig angespuckt worden, als sie da in ihrer Uniform stand und auf den Zug wartete.
Im vergangenen Jahr war ich als Redner bei einem Seminar in Thüringen eingeladen. Nach dem offiziellen Teil saßen wir alle im Garten – war gerade kein Lockdown – und tranken eine Menge Bier und irgendeinen ungarischen Schnaps, von dem man angeblich nach dem dritten das Augenlicht verliert. 15 ostdeutsche Jungs und zwei Frauen und ich, der böse Wessi. Wir haben uns phantastisch verstanden und ordentlich die Kante gegeben. Irgendwann erzählten die Jungs von ihrem Dienst in der Nationalen Volksarmee (NVA) der DDR und ich ein bisschen von meiner Zeit beim Jägerbataillon 451 in Ahlen und später bei der Panzerbrigade 21 in Augustdorf als Wehrdienstleistender in der Bundeswehr. Und das war da wenig aufregend damals, weil wir zu der Zeit Anfang der 90er Jahre eher eine Trachtengruppe waren, die im Ernstfall den Feind solange unterhalten sollte, bis die Amis kommen.
Ein wirklich wunderbarer Abend, und was mir besonders gefallen hat, dass Ost und West an diesem lauschigen Bierabend mit Rindersteaks vom Grill überhaupt keine Rolle spielte. In unterschiedlichen Teilen unseres Landes aufgewachsen, als potentielle Gegner eingeplant, aber es ging gar nicht um den Kalten Krieg und wer gewonnen oder verloren hat. Es ging um das Soldat-sein an sich, um den Stolz, die wehende Fahne des eigenen Landes zu grüßen. Es ging um uns.
Und damit kommen wir Deutschen heute immer noch nicht zurecht, weil wir diese üblen zwölf Nazi-Jahre und den großen Krieg hatten und den Massenmord an Millionen unschuldigen Menschen, vorwiegend Juden. Das ist nicht, was wir alle, unser Volk, sich einfach so wegdenken könnte. Niemals.
Mitte Oktober wurden vor dem Reichstag in Berlin die Afghanistan-Veteranen und ihr Einsatz mit einem Großen Zapfenstreich geehrt, dem höchsten militärischen Zeremoniell unserer Streitkräfte. Da ziehen Soldaten mit ernstem Gesicht, Stahlhelm auf dem Kopf und Fackeln in der Hand auf. Für linke Träumer das absolute Grauen. Viele Deutsche empfänden Unbehagen vor militärischen Ritualen, sagte der Bundespräsident gestern und weiter: «Sie wollen nicht daran erinnert werden, was der Einsatz einer Armee, auch der Bundeswehr, bedeutet. Tod und Trauma, deutsche Soldaten im bewaffneten Einsatz, in fremden Ländern – das verdrängen wir Deutsche gern.»
Ja, wir erwarten zwar, dass da Menschen sind, die uns raushauen, wenn es ernst wird. Aber wir verdrängen es, dass Soldaten nicht in erster Linie Sandsäcke auch Deichen aufstapeln und nach Hochwasserkatastrophen aufräumen, sondern in erster Linie ausgebildet werden, im Ernstfall zu kämpfen und auch zu töten. Aber wir kultivieren unser latent schlechtes Gewissen wegen der Nazi-Barbarei eben auch durch eine ungerechtfertigte Ablehnung unserer Soldaten durch Teile der linksbunten Milieus unserer Republik.
Auch die Bundeswehr ist eine Baustelle für uns Bürgerliche, und ich hoffe, dass da auch noch über die traditionellen Parteibindungen hinaus Verbündete zu finden sind, denn ich kenne auch Soldaten, die SPD wählen oder FDP, sogar einen FDP-Bundestagskandidaten in Sachsen habe ich Anfang dieses Jahres getroffen, der im Hauptberuf Offizier der Bundeswehr ist.
Wir können nicht so weitermachen, wir müssen den Frauen und Männern, die unserem Land dienen, Respekt und Anerkennung zollen für das, was sie leisten. Für uns alle leisten auch für die, die nicht begreifen, dass die Welt nicht Taka-Tuka-Land ist und Belarus nicht von Pipi Langstrumpf regiert wird. Wir brauchen eine starke Armee. Heute sogar mehr als in den vergangenen 30 Jahren.
Mit herzlichen Grüßen,
Ihr Klaus Kelle