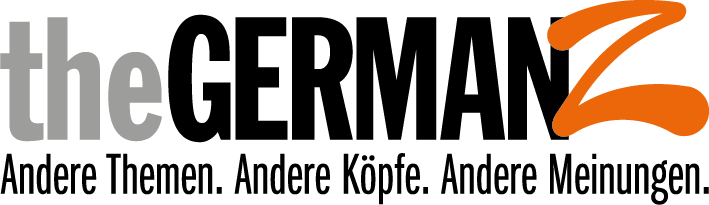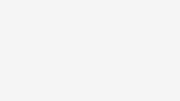von FELIX HONEKAMP
Um es gleich vorweg zu sagen: Solch eine Rede hat der US-amerikanische Senat vermutlich schon lange nicht gehört. Was John McCain seinen Politiker-Kollegen ins Stammbuch geschrieben hat – mittlerweile viel zitiert und gelobt – lässt sich hören. Die deutsche Presse wird darüber nicht müde, auch auf seine Krebserkrankung und persönliche Gegnerschaft zu Donald Trump hinzuweisen: Ersteres, und das ist schon einigermaßen zynisch, soll seine Position wohl unangreifbar machen, letzteres macht ihn zum republikanischen Aushängeschild gegen Donald Trump.
Nun muss ich sagen: Ich habe Mitgefühl mit jedem, der an einer schweren Krankheit leidet, gerade auch, wenn es sich um eine so heimtückische handelt. Aber eine Krankheit macht eine politische Position nicht besser. Und ich habe durchaus Verständnis, dass ein Politiker seine eigenen Vorstellungen durchzubringen versucht: Aber John McCain gehört nun wahrlich nicht zu den Friedensaposteln der amerikanischen Politik. Er ist als republikanischer Kandidat gegen Donald Trump angetreten und von dem nicht gerade sportlich beackert worden. Aber hätte er statt Trump die Wahl gewonnen, so würde die deutsche Journalistenlandschaft eben heute ihn statt Trump verteufeln … jeden Präsidenten, der nicht Hillary Clinton oder noch sozialistischer wäre.
Aber davon abgesehen: Ist seine Rede nicht trotzdem gut? Ist er vielleicht geläutert, womöglich durch seine Krankheit? Zeigt er die Demut, die einem Politiker eigentlich zu Eigen sein sollte? Darüber spricht er jedenfalls, wenn er sagt: „Verlassen wir uns doch wieder auf Demut und Bescheidenheit, auf unser Bedürfnis, zu kooperieren, darauf, dass wir einander brauchen, weil wir nur so lernen können, uns endlich wieder zu vertrauen. Damit wir den Menschen besser dienen können, die uns gewählt haben.“ Das klingt großartig, dienstbeflissen und bescheiden. Wie auch das hier: „Welch eine große Ehre und außergewöhnliche Chance ist es, in diesem Gremium zu dienen. Es ist ein Privileg, mit Ihnen allen dieses Mandat wahrzunehmen.“
Nun, 30 Jahre im Senat der USA zu sitzen ist sicher ein Privileg, aber das zu erkennen, bedeutet nicht gleichzeitig Bescheidenheit und Demut. Denn neben Eingeständnissen der eigenen Unvollkommenheit hat McCain auch das gesagt: „Diese Stätte ist wichtig. Die Arbeit, die wir tun, ist wichtig. Unsere seltsamen Regeln und scheinbar exzentrischen Praktiken, die unsere Debatten verzögern und die auf Kooperation zugeschnitten sind, sind wichtig. Die Verfassungsväter sahen im Senat eine Institution, die stärker abwägt, die sorgfältiger vorgeht und mehr Distanz zu den öffentlichen Leidenschaften der Stunde hält als das Repräsentantenhaus.“ Und da ist er wieder, der abgehobene Politikertypus, der besser weiß, was für ein Land gut ist, als die anderen. Der davon überzeugt ist, dass er und seinesgleichen zwingend notwendig sind, damit die Menschen durch sie geführt werden.
Und weiter geht’s in der Polithybris: „Amerika hat einen größeren Beitrag als jede andere Nation zu einer internationalen Ordnung geleistet, die mehr Menschen aus Tyrannei und Armut befreit hat als je zuvor in der Geschichte. Wir waren das beste Beispiel, der entschiedenste Anhänger und der größte Verteidiger dieser Ordnung. Wir haben keine Angst. Wir wollen nicht das Land und den Reichtum anderer Leute haben. Wir verstecken uns nicht hinter Mauern. Wir brechen in sie Löcher. Wir sind ein Segen für die Menschheit.“
Ganz ehrlich: Ich bin ein Amerika-Fan! Ich liebe dieses Land, vor allem die Menschen, die dort leben, und die vielfach (eine Statistik habe ich dazu nicht, nur persönliche Gespräche mit Menschen vieler politischer Orientierungen) ein feines Gespür für Freiheit haben, das schon dann anschlägt, wenn man seinen Müllentsorgungsdienst nicht mehr selbst bestimmen kann sondern von der Stadt verordnet bekommt. Diese Menschen würden in Deutschland verrückt werden. Aber dieses Land hat auch eine Politikerkaste, die der Überzeugung ist, dass, nachdem die Deutschen ausgefallen sind, am amerikanischen Wesen die Welt genesen muss. Und für exakt diese Politik steht McCain, für diese Politik steht auch seine Rede. Es ist eine Rede, mit der er vielleicht Donald Trump ans Bein pinkeln will, was ihm in der Presselandschaft hierzulande einen großen Vertrauensvorsprung einbringt. Aber die Rede ist trotz aller beteuerten Demut ein Dokument der weltweiten Machbarkeitsphantasien eines Politikers, der sich selbst dem Volk gegenüber für überlegen hält.
Damit ist McCain im Kern eigentlich nur ein Donald Trump in nett, diplomatischer, vielleicht nachdenklicher. Gleichzeitig aber als jahrzehntelanges Mitglied des politischen Komplexes mit allen Wassern gewaschen. Und nichts in seiner Rede deutet darauf hin, dass er mit der von ihm beschworenen Freiheit meint, dass die Menschen zukünftig von Politikern in Ruhe gelassen werden sollten. Als Liberaler kann ich die Begeisterung für die Person McCains und seine Rede daher nur sehr eingeschränkt teilen.
Bildquelle:
- John_McCain: politicsarizona